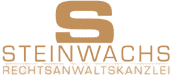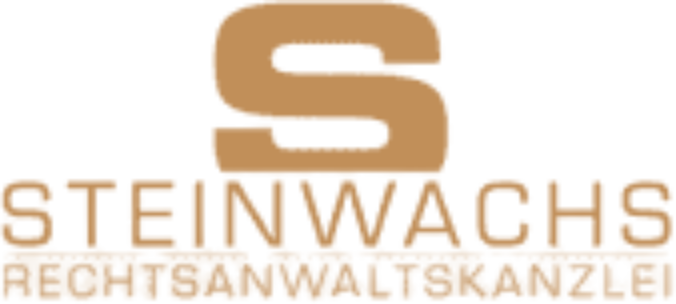I. Arbeiten in der Pandemie
Die Corona (SARS-CoV-2)-Pandemie beeinflusst sowohl das gesellschaftliche als auch das wirtschaftliche Leben in erheblichem Maße, und zwar sowohl Beschäftigte als auch Nichtbeschäftigte. Da diese Pandemielage eine Gefahr für die Gesundheit einer unbestimmten Zahl von Personen darstellt, wirkt sie gleichzeitig auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Deshalb hat sie weitreichende Auswirkungen auf das Leben jedes Einzelnen und betrifft nahezu jede wirtschaftliche Aktivität sowie die gesamte Arbeitswelt. Um Sicherheit und Gesundheitsschutz einerseits und das Hochfahren der Wirtschaft andererseits in Einklang zu bringen und damit einen Stop-and-Go-Effekt zu vermeiden, müssen beide Bereiche parallel und konsequent berücksichtigt werden.
Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen verfolgen daher das Ziel, Infektionsketten zu unterbrechen, die Bevölkerung wirksam zu schützen, die Gesundheit der Beschäftigten zu sichern, die wirtschaftliche Aktivität wiederherzustellen und gleichzeitig einen mittelfristig stabilen Zustand flacher Infektionskurven herzustellen. Dabei ist unbedingt die Rangfolge technischer über organisatorische bis hin zu personenbezogenen Schutzmaßnahmen zu beachten.
Zwei zentrale Grundsätze gelten insbesondere:
-
Unabhängig vom betrieblichen Maßnahmenkonzept müssen in Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, Mund-Nasen-Bedeckungen bereitgestellt und getragen werden.
-
Personen mit Atemwegssymptomen oder Fieber sollen sich generell nicht auf dem Betriebsgelände aufhalten. Ausnahmen gelten nur für Beschäftigte in kritischen Infrastrukturen; der Arbeitgeber muss zudem ein Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen, z. B. bei Fieber, festlegen.
II. Betriebliches Maßnahmenkonzept für zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen
Die Verantwortung für die Umsetzung notwendiger Infektionsschutzmaßnahmen liegt beim Arbeitgeber, und zwar basierend auf den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung. Deshalb sollte der Arbeitgeber sich unbedingt von den Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten beraten lassen und sich gleichzeitig mit den betrieblichen Interessensvertretungen abstimmen.
Wenn ein Betrieb über einen Arbeitsschutzausschuss verfügt, koordiniert dieser zeitnah die Umsetzung der zusätzlichen Infektionsschutz-Maßnahmen und unterstützt zudem bei der Kontrolle ihrer Wirksamkeit. Alternativ kann ein Koordinations- oder Krisenstab unter Leitung des Arbeitgebers oder einer nach § 13 ArbSchG/DGUV Vorschrift 1 beauftragten Person eingerichtet werden. In diesem Stab sollten Betriebsrat, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt aktiv mitwirken.
III. Besondere technische Maßnahmen
1. Arbeitsplatzgestaltung
Arbeitgeber sorgen dafür, dass Beschäftigte mindestens 1,5 m Abstand zu anderen Personen einhalten. Wenn dies durch organisatorische Maßnahmen nicht möglich ist, installieren sie transparente Abtrennungen. Besonders im Publikumsverkehr und an Arbeitsplätzen, an denen der Schutzabstand fehlt, schützen diese Trennungen vor direkten Kontakten.
Büroarbeit führen Beschäftigte nach Möglichkeit im Homeoffice durch. Alternativ nutzen Arbeitgeber die Raumkapazitäten so, dass Mehrfachbelegungen vermieden werden und Schutzabstände eingehalten werden.
2. Sanitärräume, Kantinen und Pausenräume
Arbeitgeber stellen hautschonende Flüssigseife und Handtuchspender bereit und erhöhen Reinigungsintervalle bei Sanitäreinrichtungen und Gemeinschaftsräumen. Regelmäßiges Reinigen von Türklinken und Handläufen verringert das Infektionsrisiko zusätzlich.
In Pausenräumen und Kantinen sorgen Arbeitgeber dafür, dass ausreichend Abstand zwischen Tischen und Stühlen besteht. Sie vermeiden Warteschlangen bei der Essensausgabe, der Rückgabe von Geschirr oder an der Kasse. Wenn nötig, verlängern sie die Ausgabenzeiten oder erwägen als letzte Maßnahme die Schließung der Kantine.
3. Lüftung
Regelmäßiges Lüften reduziert Krankheitserreger in der Luft und verbessert die Raumluftqualität. In Räumen mit raumlufttechnischen Anlagen (RLT) bleibt das Infektionsrisiko gering. Arbeitgeber schalten RLT-Anlagen nicht ab, besonders nicht in Bereichen, in denen Infizierte behandelt werden oder mit infektiösen Materialien gearbeitet wird, da sonst die Aerosolkonzentration steigt.
4. Infektionsschutzmaßnahmen für Baustellen, Landwirtschaft, Außen- und Lieferdienste sowie Transporte
Arbeitgeber achten darauf, dass Beschäftigte auch bei Kontakten außerhalb der Betriebsstätte mindestens 1,5 m Abstand halten. Sie prüfen Arbeitsabläufe dahingehend, ob vereinzeltes Arbeiten möglich ist, ohne zusätzliche Gefährdungen zu erzeugen.
Wo dies nicht möglich ist, bilden sie kleine, feste Teams von 2 bis 3 Personen, um wechselnde Kontakte zu reduzieren. Arbeitgeber richten Handhygieneeinrichtungen in der Nähe der Arbeitsplätze ein und statten Firmenfahrzeuge mit Desinfektionsmitteln, Papiertüchern und Müllbeuteln aus. Die gleichzeitige Nutzung eines Fahrzeugs durch mehrere Beschäftigte vermeiden sie. Außerdem weisen sie festen Teams eigene Fahrzeuge zu und reinigen die Innenräume regelmäßig. Schließlich optimieren sie Touren für Materialbeschaffung und Auslieferung.
5. Nutzung sanitärer Einrichtungen bei Transport- und Lieferdiensten
Arbeitgeber berücksichtigen, dass viele öffentlich zugängliche Toiletten geschlossen sind. Sie stellen sicher, dass Beschäftigte ausreichend Möglichkeiten zur Handhygiene haben und planen entsprechende Pausen ein.
6. Infektionsschutz in Sammelunterkünften
Arbeitgeber bilden kleine, feste Teams, die zusammenarbeiten. Sie stellen diesen Teams eigene Gemeinschaftseinrichtungen bereit, um Belastungen durch wechselnde Nutzung zu reduzieren.
Schlafräume belegen sie vorzugsweise einzeln. Eine Mehrfachbelegung erlauben sie nur für Partner oder enge Familienangehörige. Außerdem halten sie zusätzliche Räume bereit, um infizierte Personen frühzeitig zu isolieren. Unterkunftsräume lüften und reinigen sie regelmäßig. In Küchen stellen sie Geschirrspüler bereit, damit das Geschirr bei über 60 °C desinfiziert wird. Waschmaschinen oder ein Wäschedienst sorgen für saubere Kleidung.
7. Homeoffice
Arbeitgeber ermöglichen Homeoffice, insbesondere wenn Büroräume von mehreren Personen genutzt würden und der Schutzabstand zu gering ist. Homeoffice erleichtert zudem die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. Empfehlungen finden Beschäftigte und Arbeitgeber auf der Themenseite der Initiative Neue Qualität der Arbeit (www.inqa.de).
8. Dienstreisen und Meetings
Arbeitgeber reduzieren Dienstreisen und Präsenzveranstaltungen auf das absolut notwendige Minimum. Sie bieten Telefon- und Videokonferenzen als Alternative an. Wenn ein Treffen unvermeidbar ist, achten sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Teilnehmern.
9. Sicherstellung ausreichender Schutzabstände
Arbeitgeber passen Verkehrswege wie Treppen, Türen und Aufzüge so an, dass genügend Abstand möglich ist. Bei typischen Engstellen, zum Beispiel in der Kantine, markieren sie die Mindestabstände auf dem Boden. In Bereichen, in denen mehrere Beschäftigte zusammenarbeiten, stellen sie sicher, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Kann dies nicht gewährleistet werden, tragen Beschäftigte Mund-Nase-Bedeckungen.
10. Arbeitsmittel und Werkzeuge
Arbeitgeber ordnen Werkzeuge und Arbeitsmittel nach Möglichkeit personenbezogen zu. Wo dies nicht möglich ist, reinigen sie diese regelmäßig, besonders vor der Weitergabe an andere Beschäftigte. Alternativ verwenden Beschäftigte geeignete Schutzhandschuhe, sofern dadurch keine neuen Gefährdungen entstehen. Arbeitgeber berücksichtigen dabei auch individuelle Belastungen wie Allergien.
11. Arbeitszeit- und Pausengestaltung
Arbeitgeber reduzieren die Belegungsdichte von Arbeitsbereichen und gemeinsam genutzten Einrichtungen durch zeitliche Entzerrung, etwa versetzte Arbeits- und Pausenzeiten oder Schichtbetrieb. Sie planen Schichten so, dass möglichst dieselben Personen zusammenarbeiten, und vermeiden enge Begegnungen bei Arbeitsbeginn und -ende, etwa in Umkleideräumen, Waschräumen oder bei der Zeiterfassung.
12. Aufbewahrung und Reinigung von Arbeitsbekleidung und PSA
Arbeitgeber achten darauf, dass persönliche Schutzausrüstung (PSA) und Arbeitsbekleidung nur von der jeweiligen Person genutzt werden. Sie ermöglichen die getrennte Aufbewahrung von Arbeits- und Alltagskleidung und sorgen für regelmäßige Reinigung. Beschäftigte dürfen Arbeitskleidung zu Hause an- und ausziehen, wenn dadurch Infektionsrisiken und innerbetriebliche Kontakte vermieden werden.
13. Zutritt betriebsfremder Personen
Arbeitgeber beschränken den Zutritt betriebsfremder Personen auf ein Minimum. Sie dokumentieren Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten. Zudem informieren sie betriebsfremde Personen über die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen im Betrieb.
14. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle
Betriebe erstellen Regelungen zur schnellen Aufklärung von Verdachtsfällen. Beschäftigte mit Fieber, Husten oder Atemnot weisen sie an, das Betriebsgelände zu verlassen oder zu Hause zu bleiben. Bis eine ärztliche Abklärung erfolgt, gehen Arbeitgeber von Arbeitsunfähigkeit aus. Die betroffenen Personen wenden sich telefonisch an einen Arzt oder das Gesundheitsamt. Arbeitgeber legen im Pandemieplan fest, wie sie Kontaktpersonen informieren, um weitere Infektionen zu verhindern.
15. Psychische Belastungen
Arbeitgeber berücksichtigen psychische Belastungen durch die Corona-Pandemie, etwa Ängste, Konflikte mit Kunden oder hohe Arbeitsintensität in systemrelevanten Branchen. Sie erfassen diese Belastungen in der Gefährdungsbeurteilung und ergreifen geeignete Maßnahmen, um die psychische Gesundheit der Beschäftigten zu unterstützen.
16. Mund-Nase-Schutz und Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Arbeitgeber stellen bei unvermeidbarem Kontakt zu anderen Personen Mund-Nase-Bedeckungen bereit. In besonders gefährdeten Bereichen verwenden Beschäftigte zusätzlich PSA, um Infektionen zu vermeiden.
17. Unterweisung, Kommunikation und arbeitsmedizinische Vorsorge
Arbeitgeber informieren Beschäftigte umfassend über Präventions- und Arbeitsschutzmaßnahmen. Führungskräfte führen zentrale Unterweisungen durch, klären Fragen und sichern den Informationsfluss. Sie erklären Schutzmaßnahmen verständlich und kennzeichnen sie durch Hinweisschilder, Aushänge und Bodenmarkierungen.
Betriebsärzte beraten Beschäftigte individuell, insbesondere bei Vorerkrankungen oder besonderen Risiken. Sie schlagen Schutzmaßnahmen vor, wenn die Standardmaßnahmen nicht ausreichen, und können gegebenenfalls Tätigkeitswechsel empfehlen. Arbeitsmedizinische Vorsorge kann telefonisch erfolgen, manche Betriebsärzte bieten dafür eine Hotline an.