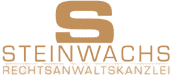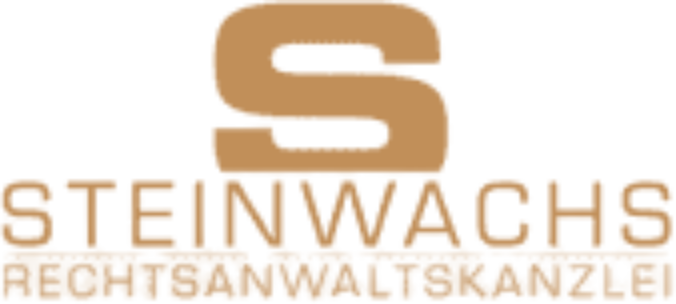Mitbestimmung und Mitwirkung des Betriebsrats
Mitbestimmung und Mitwirkung des Betriebsrats spielen eine zentrale Rolle bei der Entscheidung über die Wirksamkeit von Vertragsbestimmungen. So hatte der Erste Senat mit Urteil vom 15. April 2008 (1 AZR 86/07) über die Wirksamkeit einer Bestimmung eines Standortsicherungsvertrags zu entscheiden. Dieser Vertrag wurde von Arbeitgeber, Gewerkschaft und Betriebsrat gemeinsam unterzeichnet. Die Bestimmung war unwirksam, weil sich die Urheberschaft der einzelnen Regelungen nicht eindeutig feststellen ließ.
Eindeutigkeit bei kollektiven Normenverträgen
Beim Abschluss eines kollektiven Normenvertrags müssen Normcharakter und Urheberschaft klar erkennbar sein – sowohl im Interesse der Rechtssicherheit als auch der Rechtsklarheit. Die Schriftformerfordernisse in § 1 Abs. 2 TVG und § 77 Abs. 2 Satz 1 und 2 BetrVG dienen genau diesem Zweck. Werden Vereinbarungen von Arbeitgeber, Gewerkschaft und Betriebsrat gemeinsam unterzeichnet, muss ohne Zweifel erkennbar sein, wer Urheber der einzelnen Regelungskomplexe ist und auf welche Rechtsquellen sie sich beziehen. Andernfalls ist die Vereinbarung unwirksam. Nur jene Regelungen sind gültig, die sich eigenständig abgrenzen lassen und deren Urheber eindeutig erkennbar sind.
Videoüberwachung und Mitbestimmung
Die Wirksamkeit eines Einigungsstellenspruchs zur Einführung einer Videoüberwachung wurde vom Ersten Senat mit Beschluss vom 26. August 2008 (1 ABR 16/07) geklärt. Einzelne unwirksame Bestimmungen führen nicht automatisch zur Gesamtnichtigkeit, wenn der verbleibende Teil noch sinnvoll und geschlossen ist. Grundsätzlich müssen Einigungsstellen einen ihnen übertragenen Regelungsgegenstand vollständig lösen, können jedoch auch abstrakte Grundsätze festlegen, um die konkrete Umsetzung den Betriebsparteien oder einer neu zu bildenden Einigungsstelle vorzubehalten.
Bei der Einführung von Videoüberwachung haben Betriebsparteien das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer zu beachten (§ 75 Abs. 2 Satz 1 BetrVG, Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG). Eingriffe müssen verhältnismäßig sein, das heißt geeignet, erforderlich und angemessen, um den vorgesehenen Zweck zu erreichen. Dabei hängt die Angemessenheit von der Eingriffsintensität ab, wie der Anzahl der beobachteten Personen, der Dauer der Überwachung oder ob die Betroffenen einen konkreten Anlass gesetzt haben.
Die Zustimmung des Betriebsrats sichert verfahrensrechtlich die Beschränkung möglicher Eingriffe. Diese Zustimmung ersetzt jedoch keine inhaltlichen Grenzen der Videoüberwachung. Außerdem ist § 6b BDSG bei der Überwachung öffentlich zugänglicher Räume zu beachten.
Mitbestimmung bei Verhaltenskodizes
Der Betriebsrat ist nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG beteiligt, wenn Arbeitgeber durch Ethikrichtlinien oder Verhaltenskodizes das Verhalten der Arbeitnehmer steuern. Dabei reicht es, dass die Maßnahme auf die Steuerung des Verhaltens abzielt, nicht dass verbindliche Regeln festgelegt werden. Einzelne mitbestimmungspflichtige Regelungen begründen kein Mitbestimmungsrecht am Gesamtwerk.
Nicht mitbestimmungspflichtig sind etwa Vorschriften zur konkreten Arbeitsleistung oder Unternehmensphilosophie. Ausländische Vorschriften schließen das Mitbestimmungsrecht ebenfalls nicht aus. Der Betriebsrat darf auch nicht in die private Lebensführung eingreifen, muss aber bei Regelungen, die Persönlichkeitsrechte betreffen, besonders sorgfältig handeln.
Mitbestimmung bei Lohngestaltung
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG ist der Betriebsrat bei betrieblicher Lohngestaltung beteiligt, insbesondere bei Entlohnungsgrundsätzen und deren Änderungen. Es geht nicht um die konkrete Höhe des Arbeitsentgelts, sondern um die Struktur und Vollzugsformen. Arbeitgeberzuwendungen sind ebenfalls betroffen, sofern sie nachträglich gewährt werden. Änderungen, die auf Störungen der Geschäftsgrundlage beruhen, schließen das Mitbestimmungsrecht nicht aus.
Einstellungen und Versetzungen
Einstellungen liegen vor, wenn Personen in den Betrieb eingegliedert werden, um arbeitstechnische Zwecke zu erfüllen. Auch Leiharbeitnehmer fallen darunter, wobei Mitbestimmung erst beim konkreten Einsatz gilt. Ein Antrag nach § 99 Abs. 4 BetrVG setzt voraus, dass es sich um eine Einstellung im Sinne von § 99 Abs. 1 BetrVG handelt. Bewerbungsunterlagen, die der Arbeitgeber zur Auswahlentscheidung erstellt hat, sind vorzulegen. Formlose Notizen müssen nicht eingereicht werden.
Sozialpläne
Sozialpläne (§ 112 Abs. 1 Satz 2 BetrVG) haben eine ausgleichende und überbrückende Funktion. Die Betriebsparteien haben Beurteilungsspielräume hinsichtlich der wirtschaftlichen Nachteile für Arbeitnehmer. Dabei müssen Gleichbehandlungsgrundsätze sowie Diskriminierungsverbote eingehalten werden. Geringere Abfindungen für vorzeitige Altersrentner sind möglich, solange sie funktional begründet sind.