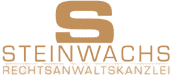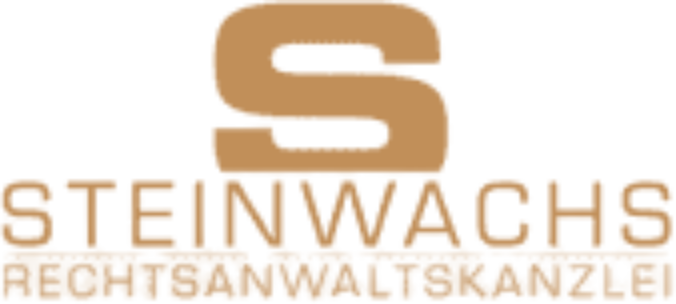Ausgleichsquittung – rechtliche Wirkung und Bedeutung
Die Ausgleichsquittung spielt eine wichtige Rolle, wenn Arbeitnehmer oder Vertragspartner eine solche erhalten oder unterzeichnen müssen. Sie kann Rechte klären, Ansprüche regeln und die Beziehung zwischen den Parteien formell abschließen.
Entscheidung des Fünften Senats
Der Fünfte Senat hat in seinem Urteil vom 7. November 2007 (5 AZR 880/06) die Rechtsqualität und den Umfang von Ausgleichsquittungen geprüft. Das Gericht stellte klar, dass verschiedene rechtliche Mittel zur Bereinigung der Rechtsbeziehung der Parteien in Betracht kommen. Dazu zählen insbesondere:
-
Erlassvertrag
-
Konstitutives Schuldanerkenntnis
-
Deklaratorisches Schuldanerkenntnis
Wesentliche Grundsätze
Ob ein negatives Schuldanerkenntnis oder lediglich eine bestätigende Wissenserklärung vorliegt, entscheidet sich nach dem Verständnis eines redlichen Erklärungsempfängers. Dieser muss nach Treu und Glauben alle Umstände prüfen und mit gebührender Aufmerksamkeit erkennen, was der Erklärende beabsichtigt hat.
Zudem gilt der Grundsatz der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung. Ein deklaratorisches negatives Schuldanerkenntnis bestätigt nur, was nach der Auffassung der Parteien ohnehin rechtens ist. Es hindert die weitere Erhebung von Ansprüchen nicht.
Anforderungen an den Verzicht
Die Feststellung eines Verzichts nach § 397 BGB unterliegt hohen Anforderungen. Selbst wenn die Erklärung des Gläubigers eindeutig erscheint, darf kein Verzicht angenommen werden, ohne dass sämtliche Begleitumstände berücksichtigt wurden.
Wenn eine Forderung entstanden ist, verbietet dies im Allgemeinen die Annahme, der Gläubiger habe sein Recht durch Erlassvertrag (§ 397 Abs. 1 BGB) oder konstitutives negatives Schuldanerkenntnis (§ 397 Abs. 2 BGB) aufgegeben.