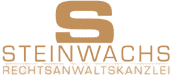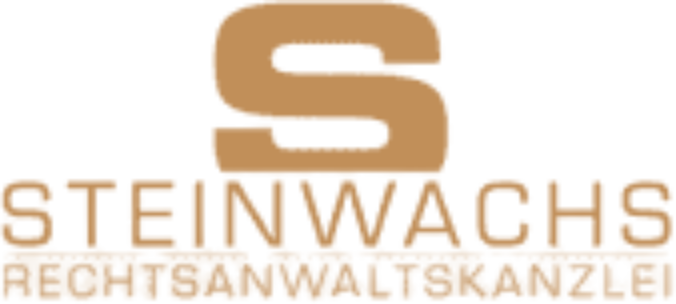Gesetzgebungsverfahren in Deutschland – einfach erklärt
Die Rolle des Bundestages
In Deutschland liegt die Gesetzgebung in den Händen der Parlamente. Der Deutsche Bundestag ist dabei das wichtigste Organ der Legislative. Er beschließt – gemeinsam mit dem Bundesrat – alle Gesetze, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen.
Neue Gesetze oder Änderungen können als Entwürfe in den Bundestag eingebracht werden. Das dürfen Abgeordnete, Fraktionen, die Bundesregierung und auch der Bundesrat. Nach einem festen Ablauf folgen dann Debatte, Beratung und Abstimmung über den Entwurf. Da Deutschland ein föderaler Staat ist, wirken auch die Länder mit. Deshalb wird jedes Gesetz auch im Bundesrat beraten. Abhängig von der Art des Gesetzes kann der Bundesrat sogar ein Vorhaben scheitern lassen.
Gesetzgebungskompetenzen
Grundsätzlich steht das Recht zur Gesetzgebung den Ländern zu. Das ergibt sich aus Artikel 70 des Grundgesetzes. Nur wenn das Grundgesetz dem Bund ausdrücklich die Kompetenz zuweist, darf dieser tätig werden.
In der Praxis liegen die meisten Gesetzgebungsbefugnisse aber beim Bund. Die Zuweisung erfolgt nach Sachgebieten. Diese sind in den Artikeln 72 ff. des Grundgesetzes geregelt, finden sich aber auch in vielen anderen Vorschriften.
Bis zum 1. September 2006 unterschied das Grundgesetz zwischen ausschließlicher, konkurrierender und Rahmen-Gesetzgebung. Mit der Föderalismusreform wurde die Rahmengesetzgebung abgeschafft. Heute gibt es nur noch zwei Arten: die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.
Gesetzesinitiativen von Bundesregierung und Bundesrat
Möchte die Bundesregierung ein Gesetz einführen oder ändern, läuft ein festes Verfahren ab. Die Bundeskanzlerin leitet den Entwurf zuerst an den Bundesrat. Dieser hat sechs Wochen Zeit, eine Stellungnahme abzugeben. Anschließend äußert sich die Bundesregierung schriftlich zu dieser Stellungnahme. Danach geht der Entwurf an den Bundestag.
Eine Ausnahme gilt für das Haushaltsgesetz. Hier erhalten Bundestag und Bundesrat den Entwurf gleichzeitig. Für Initiativen des Bundesrates gilt ein ähnliches Verfahren. Hat die Mehrheit der Mitglieder einen Entwurf beschlossen, wird er zunächst an die Bundesregierung weitergeleitet. Sie verfasst innerhalb von sechs Wochen eine Stellungnahme und übergibt den Entwurf dann an den Bundestag.
Gesetzesinitiativen aus der Mitte des Parlaments
Auch Abgeordnete können Gesetzentwürfe einbringen. Dazu braucht es entweder eine Fraktion oder mindestens fünf Prozent der Bundestagsmitglieder. Derzeit entspricht das 31 Abgeordneten.
Ein Vorteil: Diese Entwürfe müssen nicht zuerst den Bundesrat durchlaufen. Deshalb nutzt die Regierung oft ihre Fraktionen, um besonders eilbedürftige Vorhaben schnell einzubringen.
Verteilung der Drucksache
Bevor ein Entwurf beraten werden kann, geht er an den Bundestagspräsidenten. Dort wird er registriert, gedruckt und als Bundestags-Drucksache verteilt. Alle Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates und die Bundesministerien erhalten ihn.
Steht der Entwurf dann auf der Tagesordnung des Plenums, hat er den ersten Schritt geschafft. Nun beginnt die öffentliche und offizielle Behandlung im Bundestag.
Drei Lesungen im Plenum
Im Bundestag durchlaufen Gesetzentwürfe in der Regel drei Lesungen.
Erste Lesung
Die erste Lesung dient vor allem der Zuweisung an Ausschüsse. Eine Aussprache findet nur statt, wenn der Ältestenrat dies empfiehlt oder fünf Prozent der Abgeordneten es verlangen. Besonders umstrittene oder öffentliche Themen werden hier oft diskutiert.
Mindestens ein Ausschuss übernimmt die Federführung, andere beraten mit. Der federführende Ausschuss ist verantwortlich für den weiteren Ablauf.
Arbeit in den Ausschüssen
Die Detailarbeit leisten die Ausschüsse. Sie bestehen aus Abgeordneten aller Fraktionen. Hier wird der Entwurf intensiv geprüft. Die Mitglieder können Experten und Interessenvertreter anhören. Parallel arbeiten die Fraktionen in Arbeitsgruppen an ihren Positionen.
In dieser Phase entstehen oft Kompromisse. Am Ende legt der federführende Ausschuss dem Plenum einen Bericht und eine Beschlussempfehlung vor. Diese bildet die Grundlage für die zweite Lesung.
Zweite Lesung
Vor der zweiten Lesung erhalten alle Abgeordneten die Beschlussempfehlung in gedruckter Form. So sind sie gut vorbereitet.
In der Debatte zeigt jede Fraktion ihre Haltung. Änderungsanträge sind möglich und werden direkt im Plenum behandelt. Wird eine Änderung beschlossen, muss die neue Fassung erneut gedruckt werden. Mit Zweidrittelmehrheit kann dieses Verfahren abgekürzt werden, sodass die dritte Lesung sofort folgen kann.
Dritte Lesung
In der dritten Lesung darf nur noch gesprochen werden, wenn eine Fraktion oder fünf Prozent der Abgeordneten dies verlangen. Änderungsanträge sind jetzt nur noch in begrenztem Rahmen möglich. Am Ende folgt die Schlussabstimmung.
Wenn die Mehrheit zustimmt, wird der Entwurf als Gesetz an den Bundesrat weitergeleitet.
Zustimmung des Bundesrates
Der Bundesrat hat feste Mitwirkungsrechte. Er kann ein Gesetz nicht selbst ändern, aber er kann es ablehnen. In diesem Fall ruft er den Vermittlungsausschuss an. Dieser besteht aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates.
Bei Zustimmungsgesetzen muss der Bundesrat zustimmen. Dazu zählen vor allem Gesetze, die Finanzen oder die Verwaltungszuständigkeit der Länder betreffen. Auch verfassungsändernde Gesetze gehören dazu.
Bei Einspruchsgesetzen ist die Lage anders. Hier kann der Bundestag ein Gesetz auch gegen den Bundesrat durchsetzen – allerdings nur mit absoluter Mehrheit.
Inkrafttreten des Gesetzes
Hat ein Gesetz Bundestag und Bundesrat passiert, folgen weitere Schritte. Zunächst unterschreiben die Bundeskanzlerin und der zuständige Fachminister. Danach prüft der Bundespräsident das Gesetz auf Verfassungsmäßigkeit. Er fertigt es aus und unterzeichnet es.
Anschließend wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit ist es verkündet. Tritt kein spezielles Datum in Kraft, gilt das Gesetz automatisch ab dem 14. Tag nach der Veröffentlichung.