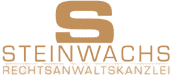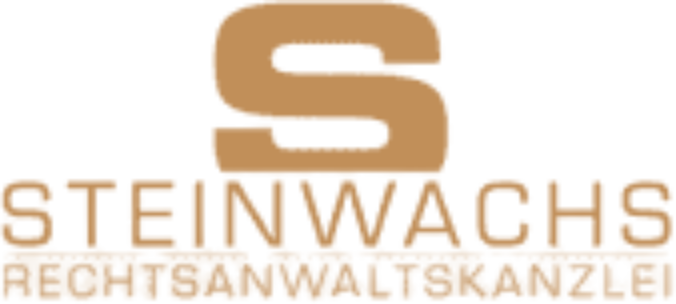Die werktägliche Arbeitszeit eines Arbeitnehmers darf nach § 3 Satz 1 ArbZG acht Stunden nicht überschreiten. Wenn das Arbeitszeitgesetz eine zulässige Verlängerung erlaubt, muss diese innerhalb von sechs oder zwölf Kalendermonaten auf durchschnittlich acht Stunden pro Werktag, also 48 Wochenstunden, ausgeglichen werden (§ 3 Satz 2, § 7 Abs. 8 ArbZG). Dabei zählen auch Zeiten von Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst ohne Einschränkung zum Ausgleich.
Der Erste Senat entschied am 24. Januar 2006 (- 1 ABR 6/05 -), dass von diesen Höchstarbeitszeiten auch durch Tarifverträge nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG nicht abgewichen werden darf. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ArbZG kann die werktägliche Höchstarbeitszeit nur dann über zehn Stunden hinaus verlängert werden, wenn regelmäßig erheblicher Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst anfällt. Ein „erheblicher Umfang“ liegt vor, wenn bei einer täglichen Höchstarbeitszeit von elf Stunden mindestens drei Stunden auf Arbeitsbereitschaft entfallen.
§ 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b ArbZG ermöglicht zudem, einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen. Trotzdem bleibt die Pflicht bestehen, die Überschreitung der werktäglichen Höchstarbeitszeit einschließlich Arbeitsbereitschaft und Bereitschaftsdienst spätestens innerhalb eines Jahres auszugleichen.
Auch die Übergangsregelung nach § 25 Satz 1 ArbZG in der Fassung vom 24. Dezember 2003 ändert daran nichts. Diese Übergangsregelung ließ bis zum 31. Dezember 2005 bestehende oder nachwirkende Tarifverträge unberührt, soweit sie von den zeitlichen Grenzen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1 ArbZG abwichen. Jedoch betrifft diese Ausnahme nicht die Höchstgrenze der zulässigen jahresdurchschnittlichen Wochenarbeitszeit (§ 3 Satz 2, § 7 Abs. 8 ArbZG).
Eine andere Auslegung des § 25 Satz 1 ArbZG wäre zudem europarechtswidrig. Denn nach Art. 6 Buchst. b der Richtlinie 2003/80/EG (Arbeitszeit-Richtlinie) darf die 48-Stunden-Grenze nicht überschritten werden.
Kontaktieren Sie uns gerne für eine rechtliche Beratung.