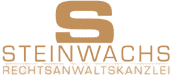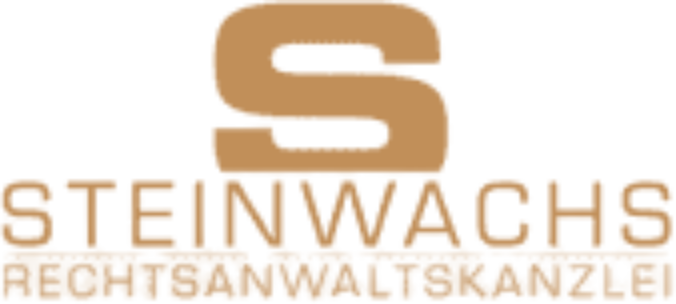Schriftform der Kündigung
§ 623 BGB verlangt, dass eine Kündigung schriftlich erfolgt. Diese Vorschrift soll sowohl Rechtssicherheit für beide Vertragsparteien gewährleisten als auch eine Beweiserleichterung im Rechtsstreit schaffen. Das Bundesarbeitsgericht stellte in einem Urteil des Sechsten Senats vom 24. Januar 2008 (6 AZR 519/07) klar, dass die Identität des Unterzeichners nicht unmittelbar beim Zugang erkennbar sein muss. Entscheidend ist, dass die Person identifiziert werden kann. Hierbei genügt ein Schriftzug, der die Identität ausreichend kennzeichnet und individuelle Merkmale aufweist, die eine Nachahmung erschweren.
Kündigungsfristen
Gemäß § 622 Abs. 4 Satz 2 BGB können tarifvertragliche Regelungen von den gesetzlichen Kündigungsfristen abweichen, wenn beide Parteien dies vereinbaren. Das Bundesarbeitsgericht entschied am 23. April 2008 (2 AZR 21/07), dass Kleinbetriebe einheitliche Kündigungsfristen von sechs Wochen zum Ende eines Kalendermonats festlegen dürfen, ohne nach Alter oder Betriebszugehörigkeit zu differenzieren. Somit ist es rechtlich zulässig, dass Tarifvertragsparteien ein vereinfachtes Modell für Kleinbetriebe anwenden, solange die gesetzlichen Grundsätze beachtet werden.
Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes
Das Kündigungsschutzgesetz gilt ausschließlich für Betriebe, die in Deutschland die Voraussetzungen des § 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG erfüllen. Die Norm verstößt nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Nach bisheriger Rechtsprechung trägt der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der betrieblichen Voraussetzungen. Dennoch muss er keine Angaben machen, die er mangels eigener Kenntnisse nicht erbringen kann. Es genügt bereits die bloße Behauptung, dass der Arbeitgeber mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt, woraufhin der Arbeitgeber die Anzahl und entsprechende Beweismittel darlegen muss.
Ordentliche Beendigungskündigung
Betriebliche Erfordernisse, die eine Kündigung nach § 1 Abs. 2 KSchG rechtfertigen, können innerbetrieblich entstehen, etwa durch Rationalisierungen, Umstellungen oder Einschränkungen der Produktion, oder außerbetrieblich, etwa durch Auftragsmangel oder Umsatzrückgang. Diese Erfordernisse müssen dringend sein, damit die Kündigung im Interesse des Betriebs notwendig ist. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit ist der Zugang der Kündigung.
Das Bundesarbeitsgericht entschied am 13. Februar 2008 (2 AZR 543/06), dass eine bloß erwogene Stilllegung oder Verkaufsverhandlung keine ausreichende Grundlage für eine Kündigung bildet. Eine solche Kündigung stellt eine Vorratskündigung dar und ist unwirksam. Unternehmen dürfen Aufgaben künftig auch an freie Mitarbeiter vergeben, solange diese Verträge tatsächlich bestehen. Dies stellt keinen Missbrauch dar, sondern fällt unter die Unternehmerfreiheit.
Arbeitnehmer müssen im Streitfall die Missbräuchlichkeit innerbetrieblicher Maßnahmen darlegen, etwa wenn organisatorische Strukturen nur geschaffen werden, um bestimmte Mitarbeiter zu verdrängen.
Konzernbezogener Kündigungsschutz
Das Kündigungsschutzgesetz ist nicht automatisch konzernbezogen. Eine Weiterbeschäftigungspflicht über Konzernunternehmen hinweg besteht nur, wenn ein anderes Unternehmen zur Übernahme ausdrücklich bereit ist oder vertragliche Vereinbarungen dies vorsehen. Allein die Möglichkeit eines Gesellschafters, Einfluss auf mehrere Unternehmen auszuüben, begründet keinen erweiterten Kündigungsschutz.
Außerordentliche Kündigung
Eine außerordentliche Kündigung kann auch aufgrund des Verdachts schwerwiegender Vertragsverletzungen oder strafbarer Handlungen erfolgen. Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber zuvor alle zumutbaren Schritte unternimmt, um den Sachverhalt aufzuklären, insbesondere durch anhörende Gespräche mit dem Arbeitnehmer. Die Anhörung dient der Aufklärung und darf nicht als Verzögerungstaktik genutzt werden.
Änderungskündigung
Bei einer Änderungskündigung muss der Arbeitgeber sowohl die Arbeitsleistung als auch die Vergütung angemessen anpassen. Die angebotene Vergütung muss den bestehenden Änderungsschutz berücksichtigen, sie muss jedoch nicht zwingend die höchste Vergütung vergleichbarer Arbeitnehmer erreichen. Beweggründe für die Vergütung sind klar zu erläutern, insbesondere wenn sie unter dem Durchschnitt liegen.
Sonderkündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
Arbeitgeber benötigen die Zustimmung des Integrationsamts nach § 85 SGB IX, bevor sie schwerbehinderte Arbeitnehmer kündigen. Das Bundesarbeitsgericht stellte am 13. Februar 2008 (2 AZR 864/06) fest, dass die dreiwöchige Klagefrist gemäß § 4 Satz 1 KSchG erst mit Bekanntgabe der Entscheidung beginnt. Teilt der Arbeitnehmer seinen Status nicht rechtzeitig mit, verfällt der Sonderkündigungsschutz nicht automatisch, er muss jedoch innerhalb der Frist geltend gemacht werden.
Fazit
Kündigungen im Arbeitsrecht sind komplex und unterliegen zahlreichen Vorschriften. Eine fehlerhafte Kündigung kann erhebliche Konsequenzen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben. Deshalb empfehlen wir, sich frühzeitig von unserer Kanzlei beraten zu lassen. Wir prüfen Ihren Fall sorgfältig, erläutern Ihre Rechte und entwickeln eine Strategie, um Ihre Interessen optimal zu vertreten. Kontaktieren Sie uns jetzt.