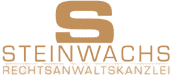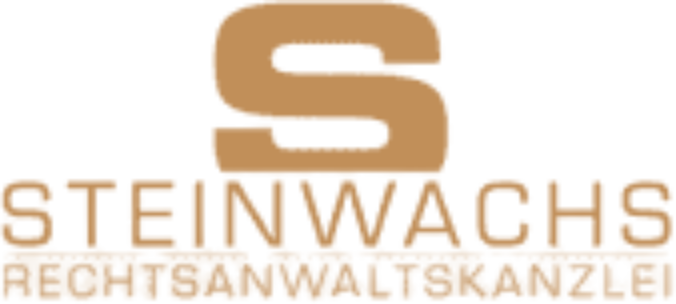Gleichbehandlung nach dem pro-rata-temporis-Grundsatz
Eine tarifliche Regelung, die Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte nach dem pro-rata-temporis-Grundsatz behandelt, verhindert eine Diskriminierung wegen Teilzeitarbeit. Das hat der Zehnte Senat am 24. September 2008 (10 AZR 634/07) bestätigt. Entscheidend ist die Gleichstellung bei der Zahlung von Entgelt oder anderen teilbaren geldwerten Leistungen.
Berechnung des Entgelts im TVöD
Nach § 24 Abs. 2 TVöD erhalten Teilzeitbeschäftigte – sofern keine andere tarifliche Regelung gilt – das Tabellenentgelt und sämtliche Entgeltbestandteile anteilig. Grundlage ist der Anteil ihrer individuell vereinbarten Arbeitszeit im Vergleich zur regelmäßigen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten.
Das bedeutet: Leisten Teilzeitkräfte ständig Schicht- oder Wechselschichtarbeit, haben sie Anspruch auf Zulagen. Diese erhalten sie jedoch nur im anteiligen Umfang.
Quantitativer Unterschied zwischen Teilzeit und Vollzeit
Teilzeitarbeit unterscheidet sich von Vollzeitarbeit nur in quantitativer, nicht in qualitativer Hinsicht. § 4 Abs. 1 Satz 2 TzBfG verbietet daher Abweichungen vom pro-rata-temporis-Grundsatz, sofern sie zum Nachteil von Teilzeitbeschäftigten führen und kein sachlicher Grund besteht.
Der Sechste Senat entschied am 24. September 2008 (6 AZR 657/07), dass bestimmte Regelungen zur Mehrarbeitsvergütung in § 34 BATO gegen dieses Verbot verstoßen. Sie sind unwirksam, wenn sie dazu führen, dass Urlaubsgeld, Zuwendungen oder vermögenswirksame Leistungen unberücksichtigt bleiben.
Vergleich der Gesamtvergütung
Maßgeblich ist, ob die Gesamtvergütung eines Teilzeitbeschäftigten, der durch Mehrarbeit dieselbe Stundenzahl wie ein Vollzeitbeschäftigter erreicht, gleich hoch ist. Nur durch diesen Vergleich lässt sich eine gerechte Vergütung sicherstellen.
Ein Ausgleich durch sachfremde Vorteile ist unzulässig. Zulässig sind nur Leistungen, die in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang stehen. So reicht etwa der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen nicht aus, um eine Benachteiligung bei der Vergütung zu kompensieren.
Fazit:
Der pro-rata-temporis-Grundsatz stellt sicher, dass Teilzeitbeschäftigte im Verhältnis zu Vollzeitkräften gerecht und ohne Benachteiligung behandelt werden. Entscheidend ist dabei nicht die Arbeitszeit an sich, sondern die Gleichwertigkeit der Vergütung für gleiche oder vergleichbare Arbeit. Tarifliche Regelungen – etwa im TVöD – müssen daher gewährleisten, dass Teilzeitkräfte alle geldwerten Leistungen anteilig erhalten.
Eine Abweichung von diesem Prinzip ist nur zulässig, wenn ein sachlicher Grund besteht. Andernfalls liegt eine Diskriminierung wegen Teilzeitarbeit vor. Der Grundsatz dient damit nicht nur der Lohnfairness, sondern stärkt auch die rechtliche Gleichstellung von Teilzeitbeschäftigten im öffentlichen und privaten Arbeitsrecht.
Unsere Kanzlei berät Sie umfassend zur gerechten Vergütungsstruktur nach dem TzBfG und TVöD, prüft Ihre Arbeitsverträge auf Diskriminierungsrisiken und unterstützt Sie bei der Durchsetzung oder Gestaltung tarifkonformer Entgeltregelungen. Kontaktieren Sie uns jetzt für eine rechtliche Einschätzung Ihrer Situation!