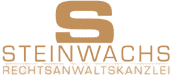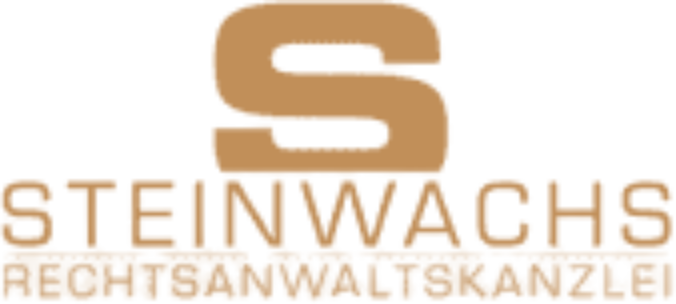Kündigung: Fristen, Rechte und Schutzmöglichkeiten
Die rechtliche Wirkung einer Kündigung ist entscheidend. Nur wer die maßgeblichen Schritte kennt, kann seine Rechte wirksam durchsetzen, wenn eine Klage erforderlich wird.
Klagefrist: Drei Wochen entscheiden
Arbeitnehmer, die eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen für unwirksam halten, müssen innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben. Ziel ist die Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis nicht beendet wurde (§ 4 KSchG).
Wird die Klage fristgerecht eingereicht, kann der Arbeitnehmer bis zum Ende der mündlichen Verhandlung auch weitere Unwirksamkeitsgründe geltend machen (§ 6 KSchG). Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied am 8. November 2007 (2 AZR 314/06), dass der Ausschluss der ordentlichen Kündigung durch Tarifvertrag rechtzeitig geltend gemacht werden muss. Es genügt nicht, nur den Tarifvertrag allgemein zu erwähnen.
Die Dreiwochenfrist gilt auch für ordentliche und außerordentliche Kündigungen in der Wartezeit (§ 13 Abs. 1 Satz 2 KSchG). Ziel ist es, schnell Klarheit zu schaffen, ob eine Kündigung wirksam ist oder nicht.
Klageverzicht: Formularlösungen meist unwirksam
Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Vertragsklauseln unwirksam, wenn sie Arbeitnehmer unangemessen benachteiligen. Ein solcher Fall liegt regelmäßig vor, wenn der Arbeitnehmer direkt nach einer Kündigung auf einem Formular auf die Klage verzichtet.
Das BAG stellte am 6. September 2007 (2 AZR 722/06) klar: Auch wenn die Klausel im Kündigungsschreiben abgesetzt und klar erkennbar ist, hält sie der Inhaltskontrolle nicht stand. Grund ist die Abweichung von der gesetzlichen Regelung in § 4 KSchG. Ohne Gegenleistung ist ein solcher Verzicht regelmäßig unwirksam.
Kündigung während der Wartezeit
Innerhalb der ersten sechs Monate besteht kein allgemeiner Kündigungsschutz nach § 1 Abs. 2 KSchG. Trotzdem kann eine Wartezeitkündigung gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoßen.
Am 28. Juni 2007 entschied das BAG (6 AZR 750/06), dass eine Kündigung nicht allein deshalb unwirksam ist, weil es alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben hätte. Diese Pflicht zur Prüfung gilt erst im Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 KSchG. Auch Verfahren nach § 84 SGB IX haben während der Wartezeit keine kündigungsrechtlichen Folgen.
Abmahnung und Kündigung
Spricht ein Arbeitgeber eine Abmahnung aus, verzichtet er in der Regel auf das Recht zur Kündigung wegen des abgemahnten Vorfalls. Das gilt auch in der Wartezeit. Kündigt der Arbeitgeber unmittelbar danach, spricht dies für einen Zusammenhang mit der Pflichtverletzung (BAG, 13.12.2007 – 6 AZR 145/07).
In einem solchen Fall muss der Arbeitgeber nachweisen, dass andere Gründe die Kündigung rechtfertigen. Auch die Frage der Unterschrift wurde geklärt: Zeichnet ein Angestellter ein Kündigungsschreiben mit „i. A.“ auf dem Briefbogen des Arbeitgebers, gilt die Schriftform nach § 623 BGB in der Regel als gewahrt.
Ordentliche Kündigung und Sozialauswahl
Nach § 1 Abs. 3 KSchG ist eine Kündigung sozial ungerechtfertigt, wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Unterhaltspflichten und eine Schwerbehinderung nicht ausreichend berücksichtigt. Arbeitnehmer, die einem Betriebsübergang widersprochen haben, können sich ebenfalls darauf berufen.
Seit 2004 ist die Sozialauswahl jedoch klar auf diese vier Kriterien beschränkt. Die Gründe für den Widerspruch gegen einen Betriebsübergang spielen keine Rolle mehr (BAG, 31.05.2007 – 2 AZR 218/06, 2 AZR 276/06).
Die Sozialauswahl ist betriebsbezogen. Sie kann nicht auf Betriebsteile beschränkt werden, auch wenn räumliche Distanz besteht. Maßgeblich ist die organisatorische Einheit (§ 23 KSchG). Nur in besonderen Fällen, etwa bei Schlüsselpositionen mit hoher Einarbeitungsintensität oder Kundenbindung, dürfen einzelne Arbeitnehmer aus der Sozialauswahl herausgenommen werden.
Bei Interessenausgleichen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat tritt nach § 1 Abs. 5 KSchG eine Vermutung ein, dass Kündigungen durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt sind. Dann muss der Arbeitnehmer die Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl beweisen.
Personenbedingte Kündigung und Krankheit
Nach § 1 Abs. 2 KSchG ist eine Kündigung auch möglich, wenn der Arbeitnehmer die erforderliche Eignung oder Fähigkeit nicht mehr besitzt. Beispiel: Ein Werkstudent verliert seine Sozialversicherungsfreiheit, weil das Studium zu lange dauert. Das reicht für eine Kündigung jedoch nicht aus (BAG, 18.01.2007 – 2 AZR 731/05). Hier kommt höchstens eine Änderungskündigung in Betracht.
Bei krankheitsbedingten Kündigungen gilt: Ist ein Arbeitnehmer länger als sechs Wochen im Jahr arbeitsunfähig, muss der Arbeitgeber ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchführen (§ 84 Abs. 2 SGB IX). Zwar ist das BEM keine Wirksamkeitsvoraussetzung, doch stärkt es den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ohne BEM muss der Arbeitgeber umfassend darlegen, warum eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist (BAG, 12.07.2007 – 2 AZR 716/06).
Änderungskündigung
Eine Änderungskündigung ist wirksam, wenn sie auf betriebliche Gründe gestützt wird und der Arbeitnehmer die Änderungen billigerweise hinnehmen muss. Nach der Rechtsprechung des BAG (29.03.2007 – 2 AZR 31/06) gilt dies insbesondere dann, wenn eine Beendigungskündigung sonst unvermeidbar wäre.
Liegt ein Interessenausgleich vor, in dem Arbeitnehmer namentlich genannt werden, greift auch bei Änderungskündigungen die gesetzliche Vermutung aus § 1 Abs. 5 KSchG (BAG, 19.06.2007 – 2 AZR 304/06).
Sonderkündigungsschutz schwerbehinderter Arbeitnehmer
Schwerbehinderte genießen besonderen Schutz. Nach § 85 SGB IX ist für ihre Kündigung die Zustimmung des Integrationsamts erforderlich. Auch wenn ein Präventionsverfahren nach § 84 SGB IX nicht zwingend ist, kann eine Kündigung ohne dieses Verfahren gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip verstoßen.
Eine einmal erteilte Zustimmung des Integrationsamts gilt für einen Monat (§ 88 Abs. 3 SGB IX) und kann auch mehrfach genutzt werden, solange der Kündigungsgrund gleichbleibt (BAG, 08.11.2007 – 2 AZR 425/06).
Der Sonderkündigungsschutz gilt zudem für anerkannte Schwerbehinderte und für Gleichgestellte, wenn der Antrag rechtzeitig – mindestens drei Wochen vor Kündigung – gestellt wurde (§ 90 Abs. 2a SGB IX). Ziel dieser Regelung ist es, Missbrauch zu verhindern (BAG, 06.09.2007 – 2 AZR 324/06).
Sonderkündigungsrecht des Arbeitnehmers
Nach § 12 KSchG kann ein Arbeitnehmer nach erfolgreicher Kündigungsschutzklage binnen einer Woche erklären, dass er das Arbeitsverhältnis nicht fortsetzen möchte, wenn er während des Prozesses bereits eine neue Stelle angenommen hat. Dieses Sonderkündigungsrecht gilt jedoch nicht, wenn stattdessen eine selbständige Tätigkeit aufgenommen wurde (BAG, 25.10.2007 – 6 AZR 662/06).
Fazit: Rechtliche Beratung im Kündigungsschutzrecht
Das Kündigungsschutzrecht ist komplex und voller Fallstricke – von der ordentlichen Kündigung über Änderungskündigungen bis hin zum Sonderkündigungsschutz. Arbeitgeber müssen zahlreiche gesetzliche Vorgaben sowie aktuelle Rechtsprechung beachten, um wirksam kündigen zu können. Arbeitnehmer wiederum haben vielfältige Möglichkeiten, sich gegen eine unrechtmäßige Kündigung zu wehren und ihre Rechte zu sichern.
Gerade weil jeder Einzelfall unterschiedlich ist, empfiehlt es sich, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen. Wir unterstützen Sie kompetent bei der Prüfung einer Kündigung, vertreten Sie im Kündigungsschutzprozess und beraten präventiv zu Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsverhältnis. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung – gemeinsam finden wir die passende Lösung. Kontaktieren Sie uns gerne, wir kümmern uns bestmöglich um Ihr Anliegen.
Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen folgende Seiten zum Thema: