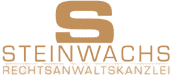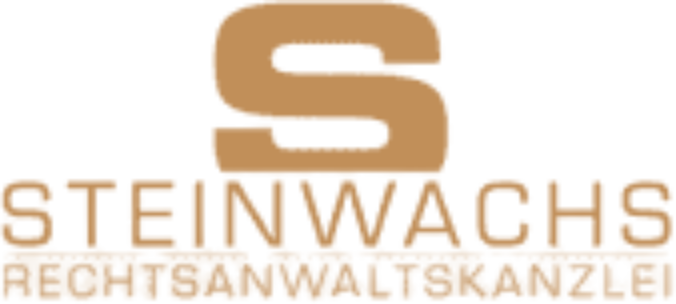In Deutschland regelt das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) genau, wann Arbeitgeber befristete Arbeitsverträge abschließen dürfen. Grundsätzlich müssen Arbeitgeber jede Befristung schriftlich festhalten, wie § 14 Abs. 4 TzBfG vorschreibt. Unterlassen sie dies, wandelt das Gesetz den Vertrag automatisch in einen unbefristeten Vertrag um. Dieses Prinzip gilt sowohl für die klassische kalendermäßige Befristung als auch für die Zweckbefristung, bei der das Arbeitsverhältnis endet, sobald ein zukünftiges Ereignis eintritt, dessen genauer Zeitpunkt noch nicht feststeht (§ 3 Abs. 1 Satz 2 TzBfG).
Das Schriftformerfordernis erfüllen Arbeitgeber, indem sie dem Arbeitnehmer einen unterzeichneten Vertragsentwurf übergeben und dieser ihn ebenfalls unterschreibt. Dadurch schaffen beide Parteien Transparenz, und im Streitfall erhalten sie Rechtssicherheit.
Sachgrundlose Befristung
Arbeitgeber dürfen Arbeitsverträge bis zu zwei Jahre ohne sachlichen Grund befristen (§ 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG). Innerhalb dieser Frist verlängern sie den Vertrag bis zu dreimal, solange die Gesamtdauer zwei Jahre nicht überschreitet. Gleichzeitig verhindert das Gesetz, dass Arbeitnehmer, die bereits beim gleichen Arbeitgeber gearbeitet haben, erneut sachgrundlos befristet werden (§ 14 Abs. 2 Satz 2 TzBfG). Allerdings machen die Gerichte Ausnahmen, wenn der Arbeitnehmer zuvor bei konzernverbundenen Gesellschaften beschäftigt war.
Zweckbefristung
Bei einer Zweckbefristung endet das Arbeitsverhältnis automatisch, sobald der vereinbarte Zweck erreicht ist. Arbeitgeber müssen den Arbeitnehmer mindestens zwei Wochen vorher schriftlich informieren (§ 15 Abs. 2 TzBfG). Arbeitnehmer können die Unwirksamkeit einer Befristung innerhalb von drei Wochen nach Vertragsende geltend machen (§ 17 Satz 1 TzBfG). So stellen die Gesetze sicher, dass Arbeitnehmer nicht benachteiligt werden, wenn die Befristung formale Fehler enthält oder der Zweck unklar ist.
Sachliche Gründe für Befristungen
Arbeitgeber setzen Befristungen auch aus sachlichen Gründen ein. Typische Beispiele sind:
- Vertretung eines anderen Arbeitnehmers (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TzBfG),
- vorübergehende Finanzierung durch Haushaltsmittel (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 TzBfG),
- oder eine Befristung auf Grundlage eines gerichtlichen Vergleichs (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 TzBfG).
In jedem Fall müssen Arbeitgeber die Voraussetzungen nachweisen, um die Befristung rechtlich abzusichern.
Vertragsverlängerung
Wenn Arbeitgeber einen befristeten Vertrag verlängern, vereinbaren sie dies schriftlich. In der Regel ändern sie nur die Laufzeit, während andere Arbeitsbedingungen unverändert bleiben. Wenn sie zusätzliche Bedingungen ändern, passen sie diese gezielt an, ohne die ursprüngliche Vereinbarung zu verletzen.
Aktuelle Rechtsprechung
Die Rechtsprechung, besonders vom Siebten Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG), schärft die Anforderungen an Schriftform, Zweckbefristung, Verlängerung und sachliche Gründe. Beispielsweise bestätigte der BAG mehrfach, dass die Rückwirkung des Hochschulzeitvertragsrechts verfassungsgemäß ist. Diese Urteile zeigen deutlich, dass Arbeitgeber die gesetzlichen Vorgaben genau einhalten müssen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Kontaktieren Sie uns gerne für eine rechtliche Beratung. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen.