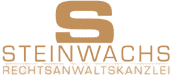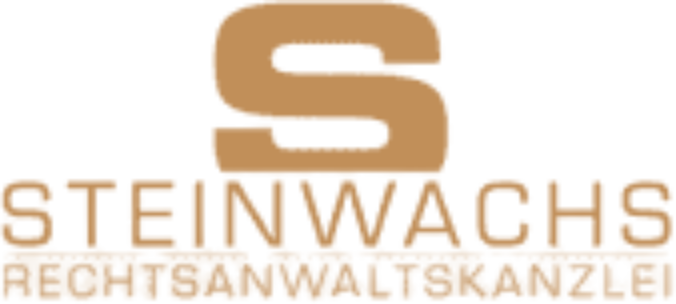Vereins- und Verbandsrecht in Deutschland
Das Vereins- und Verbandsrecht beschäftigt sich umfassend mit der Gründung, der Organisation sowie der rechtlichen Ausgestaltung von Vereinen und Verbänden in Deutschland. Dabei basiert es auf der durch die Verfassung garantierten Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 GG, die es allen Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen und ihre Interessen gemeinsam zu vertreten.
Grundlagen des Vereins- und Verbandsrechts
Vereine sind dauerhafte Zusammenschlüsse von Personen, die eine eigene Körperschaftsstruktur besitzen. Sie werden in den §§ 21 ff. BGB geregelt. Verbände hingegen sind meist Interessengemeinschaften, die in der Regel ebenfalls die Rechtsform eines Vereins haben. Sie agieren überregional und verfolgen das Ziel, die Interessen ihrer Mitglieder in Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung zu vertreten und zu fördern.
Arten von Vereinen
Im Vereins- und Verbandsrecht lassen sich verschiedene Vereinsarten unterscheiden, die jeweils unterschiedliche rechtliche Anforderungen und Möglichkeiten aufweisen:
-
Eingetragener Verein (e.V.)
-
Wirtschaftlicher Verein
-
Nicht-rechtsfähiger Verein
Eingetragener Verein (e.V.)
Der eingetragene Verein ist die klassische Grundform eines Vereins und in § 21 BGB geregelt. Er darf nicht wirtschaftlicher Art sein. Ein Verein muss mindestens 7 Mitglieder haben (§ 56 BGB) und über eine Satzung verfügen, die die Struktur, Aufgaben und Rechte der Mitglieder festlegt.
Der Verein handelt durch seine Organe, nämlich durch die Mitgliederversammlung und den Vorstand. Erst durch die Eintragung ins Vereinsregister erlangt der e.V. seine eigene Rechtsfähigkeit. Dadurch kann er rechtsverbindlich handeln, Verträge abschließen und vor Gericht auftreten.
Wirtschaftlicher Verein
Der wirtschaftliche Verein (§ 22 BGB) erlangt die Rechtsfähigkeit durch staatliche Verleihung. In der Praxis ist dies selten der Fall, wobei ein Beispiel die GEMA darstellt. In den meisten Fällen nutzen wirtschaftlich tätige Zusammenschlüsse jedoch klassische Kapitalgesellschaften wie die AG oder GmbH, da diese praxisnaher und flexibler sind. Daher wird § 22 BGB in der Realität oft durch Vorschriften des AktG oder GmbHG verdrängt.
Nicht-rechtsfähiger Verein
Der nicht-rechtsfähige Verein ist in § 55 BGB geregelt. Auf ihn finden die Vorschriften über die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB) entsprechend Anwendung, was bedeutet, dass die Mitglieder persönlich haften, zugleich aber die organisatorische Freiheit weitgehend erhalten bleibt.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vereins- und Verbandsrecht die Rechte, Pflichten und Strukturen von Vereinen und Verbänden klar regelt. Mit professioneller anwaltlicher Beratung lassen sich die gesetzlichen Vorgaben effektiv umsetzen, rechtliche Risiken minimieren und die Interessen der Mitglieder optimal vertreten. Insbesondere bei der Gründung, Organisation oder Konfliktlösung bietet die kompetente Unterstützung durch eine Kanzlei erheblichen Mehrwert.